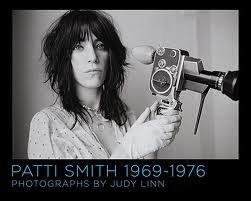Jonas Jonasson
In den 1970er-Jahren dachte man, dass Alterungsprozesse und das
erreichbare Lebensalter im Wesentlichen genetisch festgelegt sind. Ob man lange
rüstig und aktiv sein kann oder schnell degeneriert, wäre demnach eine Frage
der Gene – und damit Schicksal. Diese Ansicht hat sich deutlich verändert.
Heute gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich nur rund 30 Prozent des
Alterungsprozesses auf genetische Faktoren zurückführen lassen. 70 Prozent
werden indes durch unsere Lebensweise beeinflusst. Dazu passt die Beobachtung
von der japanischen Insel Okinawa. Dort werden die Menschen so alt wie sonst
nirgendwo auf der Welt. Man hat festgestellt, dass die Menschen auf Okinawa von
Kindesbeinen an lernen, sich niemals zu überessen. Es bleiben immer rund 30
Prozent des Magens ungefüllt. Die Art der Ernährung scheint also ein
wesentlicher Aspekt dieses Älterwerdens zu sein. Entscheidend ist aber die
Botschaft: Es liegt durch unsere Lebensweise zum größten Teil in unserer
eigenen Hand, wie wir älter werden.
Fünf Dinge sind wirklich essenziell für ein langes und gesundes Leben:
Ernährung, Bewegung, Regeneration,
Entgiftung sowie insbesondere Stressmanagement und Lebensfreude.
Da hat Allen Karlsson anscheinend alles richtig gemacht.
Allan Karlsson ist die Hauptperson in Jonas Jonasson`s Roman „Der
Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Allen Karlsson blickt
auf ein sehr ereignisreiches Leben zurück. Er ist weit herum gekommen in der
Welt, hat, obwohl gar nicht an Politik interessiert, einige wichtige politische
Persönlichkeiten getroffen. Doch jetzt soll er seinen 100. Geburtstag im
Altersheim verbringen, wo allerlei merkwürdige Verbote gelten. Da Allan sich
allerdings sowohl körperlich als auch geistig noch recht fit und gar keine Lust
auf die Geburtstagsparty hat, steigt er kurzerhand aus seinem Fenster und macht
sich auf den Weg zu Bahnhof. Dort stielt er einem jungen Mann seinen Koffer, der ganz zufällig keine
Wechselkleidung, sondern 50 Millionen illegales Geld, enthält. Mit seinen neu gewonnen Freunden stürzt Allan sich in ein Abenteuer.
Der Roman spielt in der Gegenwart, springt jedoch immer wieder in die
Vergangenheit zurück und schildert chronologisch Allans bisheriges Leben.
Allen Karlsson der Jahrhundertzeugen, der wider Willen in sämtliche
wichtigen politischen Ereignisse verwickelt wird und es dennoch schafft, sich
aus allem herauszuhalten, kann vielen gewissenhaft rezensierten Werken der
Gegenwartsliteratur das Wasser reichen - oder besser: den Wodka.
Denn wie man es bei einem so durch und durch schwedischen Epos
erwarten darf, wird hier ordentlich getrunken und gern darüber geredet. Vor
Leuten, die nicht trinken, solle er sich in Acht nehmen, hat der Romanheld
Allan Karlsson von seinem Vater gelernt, der in Russland vom Sozialisten zum Zarenverehrer
mutierte und bei der Verteidigung seines zehn Quadratmeter großen, zur
"unabhängigen Republik" erklärten Privatgrundstücks von Lenins
Soldaten erschossen wurde. Dieser Lebenslauf en miniature bildet das Prinzip
der gesamten Erzählung ab: Ideologien werden als lächerliche Konstrukte
entlarvt, und die Tragik des kleinen Mannes wird mit der Komik des
weltpolitischen Geschehens verflochten. Als Lebensmotto taugt, wie sich
herausstellt, einzig der Satz, den Allans Mutter sprach, als sie vom Tod ihres
Gatten erfuhr: "Es ist, wie es ist, und es kommt, wie es kommt." Das
heißt freilich nicht, dass das, was ist und was kommt, keinen Spaß machen darf.
Der Schreibstil des Romans ist sehr locker gehalten und mit Witz
geschrieben. Während des Lesens musste ich viel lachen und schmunzeln. Die
Mischung aus Gegenwart und Vergangenheit finde ich sehr passend. Somit bekommt
man einen Überblick über wichtige Krisen der letzten hundert Jahre, die
allerdings übertrieben dargestellt sind.
Ein gelungenes Buch.
Der Hundertjährige der aus dem
Fenster stieg und verschwand, Jonas Jonasson, 416 Seiten, carl's books- Verlag,
ISBN-10: 3570585018